
Die Äppelkähne waren eine „verloren gegangene Verpackung“, es waren billig gebaute Transportkähne, die ungefähr 200 Tonnen Ladung aufnehmen konnten. Der Ursprung ist im Kaffenkahn zu finden. Diese hölzernen, meist aus Kiefer und Fichte gebauten Wasserfahrzeuge waren in der Regel einfach gebaut, hatten keinen Steven, sondern an den Schiffsenden hochgezogene Bodenplanken, an die seitlich die Planken befestigt waren. Das so entstandene Schiffsende, die so genannte Kaffe, gab dem Kahn schließlich den Namen. Gestakt, getreidelt oder bei günstigem Wind gesegelt, wurden alle erdenklichen Waren transportiert. Die Berliner nannten diese Kähne Äppelkahn, weil diese Kähne in Böhmen mit Äpfeln beladen wurden und dann flussabwärts bis Berlin fuhren. Dort wurde das Obst verkauft. Man spricht auch oft von böhmischen Zillen.
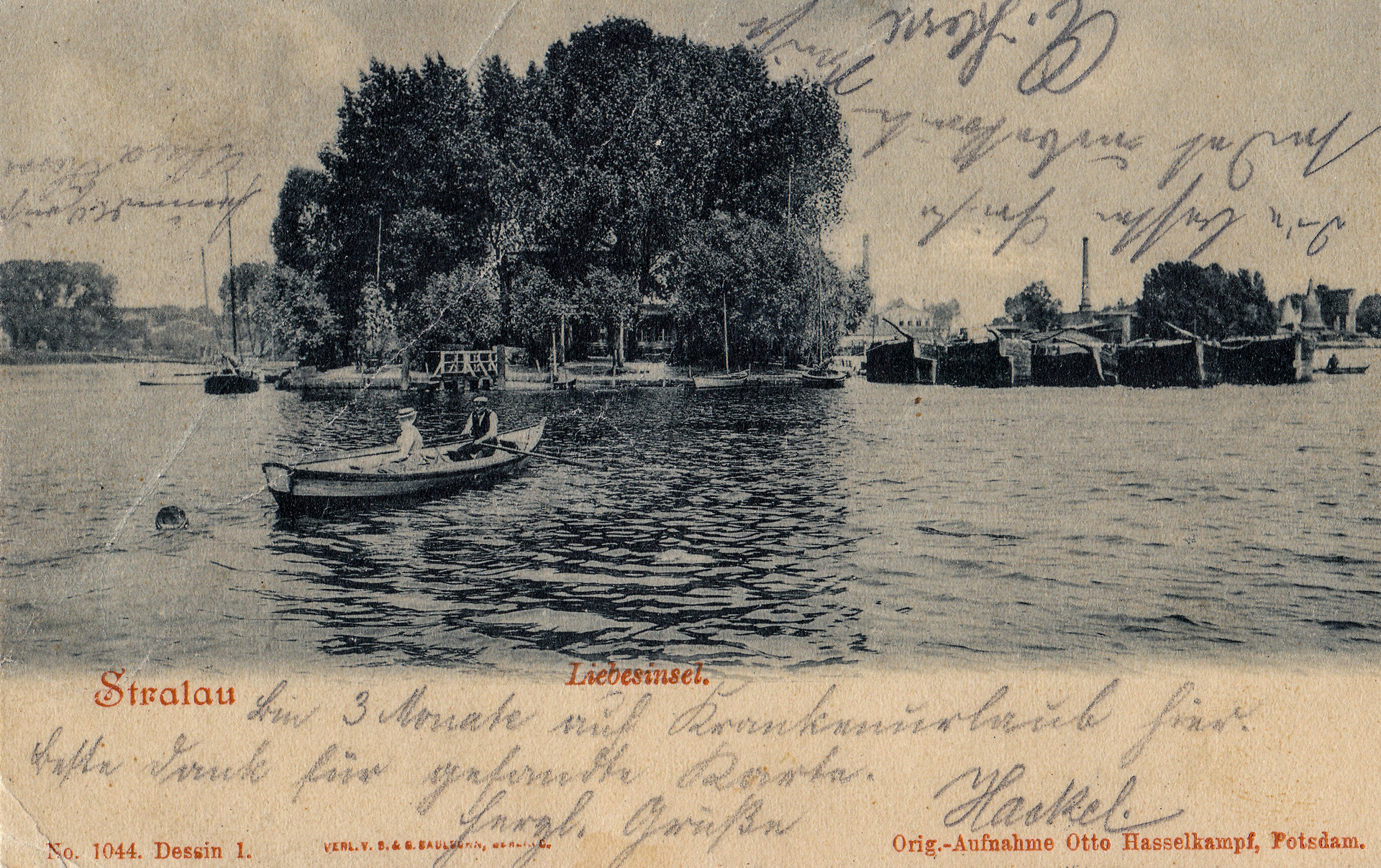
Es rentierte sich nicht, diese Kähne wieder leer nach Böhmen zurück zu fahren, es war preiswerter, diese in Böhmen neu zu bauen. Daher wurden die Zillen ausgeschlachtet. Das heißt, man hat diese Kisten auseinander genommen und das Holz verwertet. Das war eine unvorstellbare Menge an Holz. Die Bohlen waren aus astreinen Nadelhölzern und ca. 40 cm breit und 12 m lang. Diese Hölzer hatte man zu Werkbänken oder ähnliches verarbeitet. Für die Zillenschlächter war dies ein sehr lukratives Geschäft.
Die letzten dieser Schiffe sind während des Krieges gesprengt und versenkt worden, um das Übersetzen der russischen Armee zu erschweren. Zu dieser Zeit sind die Zillen mit einem Schleppdampfer gezogen worden, an dem vier dieser Zillen dranhingen. Somit konnten 1.000 Tonnen an Güter bewegt werden. Zum Manövrieren sind drei Mann auf dem Dampfer notwendig gewesen, der Kapitän, ein Heizer und ein Schiffsjunge. Auf jeder Zille waren zwei Mann Besatzung, also 11 Personen pro Schleppverband, das macht heute ein Schleppkahn mit zwei Personen schneller und effektiver. Nach dem Krieg gab es keine Schiffsschleppverbände mehr. Die versenkten Zillen wurden aufgeslippt und an Land ausgeschlachtet. Einzig der Boden blieb erhalten, da dieser nicht verfault, dieser war immer im Wasser und ist somit beständig. Auf dem Holzboden setzte man in Stahl wieder Seitenwände auf und hatte somit Schleppkähne, die scheinbar aus Stahl waren, aber in Wirklichkeit einen Holzboden hatten. Dies war in den 40-ziger und Anfang der 50-ziger Jahre quasi ein Übergang bis die Schubschiffe gebaut und eingesetzt wurden.
Günter Jürgens hat für uns im Jahr 2009 seine Unterlagen durchgesehen, um festzustellen, welche Schiffstypen im Norddeutschen Raum um 1900 verkehrten.

Kaffenkahn
etwa ab 1700, der letzte Kaffenkahn soll 1898 in Uckermünde gebaut worden sein.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite von Kaffenkahn-ev.de
Die Quatze
11-16 m lang, 4-6,25 m breit, 1,5-2,5 m tief, 9 – 40 BRT, zum Teil seetüchtige Fahrzeuge, die bis zum Bottnischen Meerbusen und nach Südschweden verkehrten.
Der Pommersche Haffkahn
Länge bis 40,2 m, Breite bis 4,6 m (Finowmaß), Höhe bis 2,5 m, 250 -300 t, Verbreitungsgebiet Stettiner Haff, Oder, märkische Wasserstraßen, Elbe bis Hamburg
Buk- oder Bockkähne
Abart der Kaffenkähne aber auch ohne Kaffe, verkehrten auf der Ihna, Tollense, Trebel und Dahme
Steven- oder Spitzkahn
Bis 500 t, Stralsund bis Rügen, auch Fahrten bis Berlin, Stettin
Zillen
Fluß- oder Kanalschiff, Finowmaß 40,2 m lang, 4,6 m breit, auch Finowkanalgröße genannt, 150 – 220 t, in Ausnahmefällen bis 50 m Länge, 6.00 m Breite, bis 500 t, Ursprung Böhmen, meist für den Transport von Braunkohle, Basaltschotter oder Obst nach Magdeburg, Hamburg und Berlin verwendet, viele wurden bereits nach der ersten Fahrt in den sog. „Zilleschlächtereien“ zerschlagen und als gebrauchtes Holz verkauft (jährlich etwa 400 !), manche Zillen wurden durch Kleinschiffer aufgekauft und noch 3-4 Jahre lang zur Beförderung von Baustoffen und anderen weniger wertvollen Dingen verwendet. Anm. der Redaktion: Viele der Zillen sind zum Beispiel für den Transport von Baumaterialien zwischen dem nahegelegenen Rüdersdorfer Kalksandwerk und dem Osthafen in Berlin eingesetzt worden.
Berliner Zillen (Stevenzillen oder auch als Kaffenzillen)
aus Kiefernholz, bessere Verarbeitung, längere Lebensdauer, bis 225 t
Oderkahn
Finowkanalmaß, von der Saale bis zum Memelstrom, 100 – 150 t
Stevenkahn
Finowkanalmaß oder auch nach Berliner Maß 46,6 m Länge, 4,6 m Breite
Zu den beschriebenen Schiffstypen ließe sich noch unendlich viel mehr sagen. Wer mehr wissen will, der muss eben sehr viel tiefer in die Materie einsteigen. Es werden irgendwo noch Schiffe aus dieser Zeit unter dem Schlamm der Seen und Flüsse begraben liegen. Wie man sie findet, auch unter dem Schlamm, könnt Ihr hier lesen…
Zuarbeit: Manfred Ernst, Reimer Hoffmann und Günter Jürgens – Vielen Dank für die wertvollen Hinweise!



